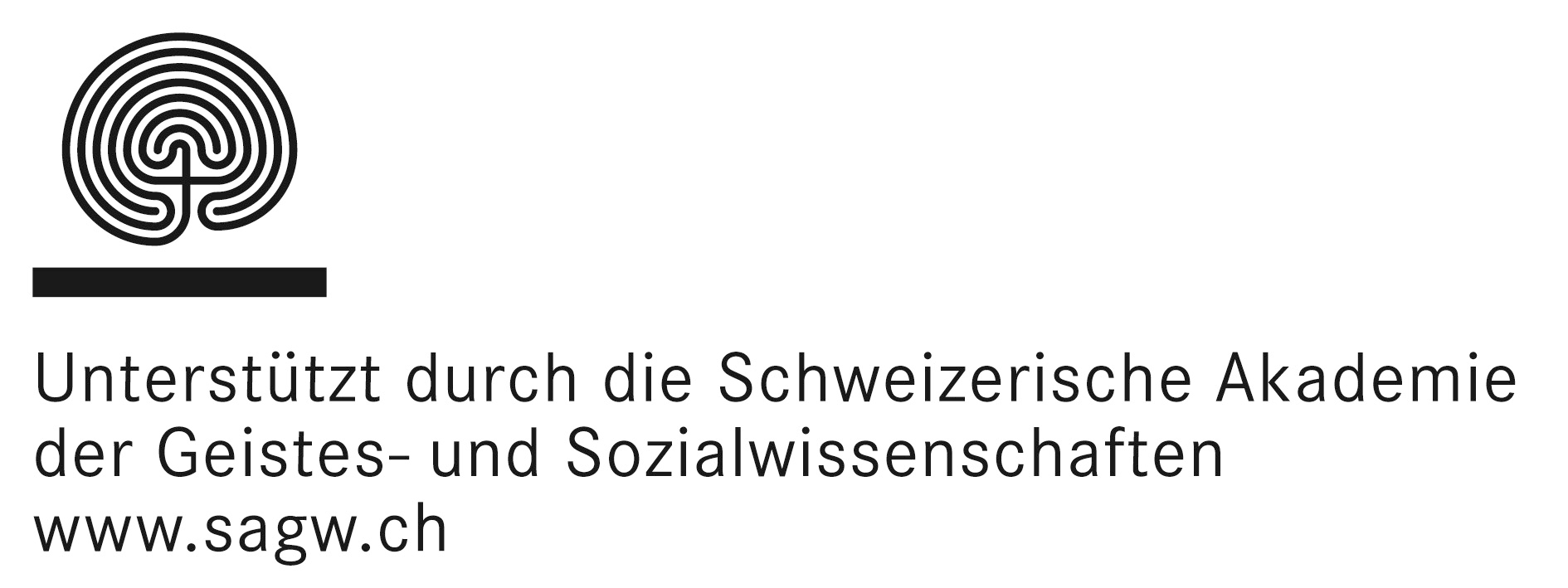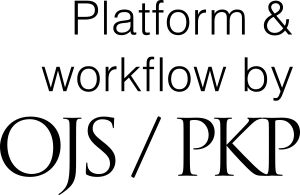Bewerten und Beurteilen. Dimensionen religionskundlicher Urteilsbildung
DOI:
https://doi.org/10.26034/fr.zfrk.2022.110Abstract
In Katharina Franks Kompetenzmodell für religionskundlichen Unterricht stellt die Urteilskompetenz eine der fünf Kernkompetenzen dar. Sie ist dabei auf Fremddarstellungen von Religionen begrenzt – religiöse Selbstdarstellungen wie Texte oder Praktiken werden von der Urteilsbildung explizit ausgenommen. Dieser Beitrag plädiert für eine Erweiterung des Kompetenzmodells auf der Grundlage der aus der Geschichtsdidaktik bekannten Unterscheidung von Sach- und Werturteil und für eine Übertragung von Sach- und Werturteilsbildung auf religiöse Selbstdarstellungen. Eingeordnet wird dieser Vorschlag in die religionswissenschaftliche Diskussion über „Wertfreiheit“ allgemein und die Neutralität des Faches hinsichtlich einer Werturteilsbildung im Besonderen. Unter Rückgriff auf die Positionen von Max Weber und Russel T. McCucheons (marxistische Religionskritik) wird die Frage diskutiert, ob Religionswissenschaftler_innen, Lehrpersonen und auch Schüler_innen religiöse Selbstdarstellungen normativ bewerten dürfen oder sogar sollten. Der Beitrag argumentiert, dass Werturteile im Unterricht gebildet werden können, diese jedoch nicht mehr Bestandteil der fachwissenschaftlichen Kommunikation über religiöse Gegenstände sind und von dieser auch klar getrennt werden müssen. Auch für Sachurteile ist ein religionskundlicher Bezugsrahmen unabdingbar, für den einige Kriterien vorgeschlagen werden.Downloads
Veröffentlicht
29.03.2022
Ausgabe
Rubrik
Tagungsbeiträge
Lizenz
Copyright (c) 2022 Markus Rassiller

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.