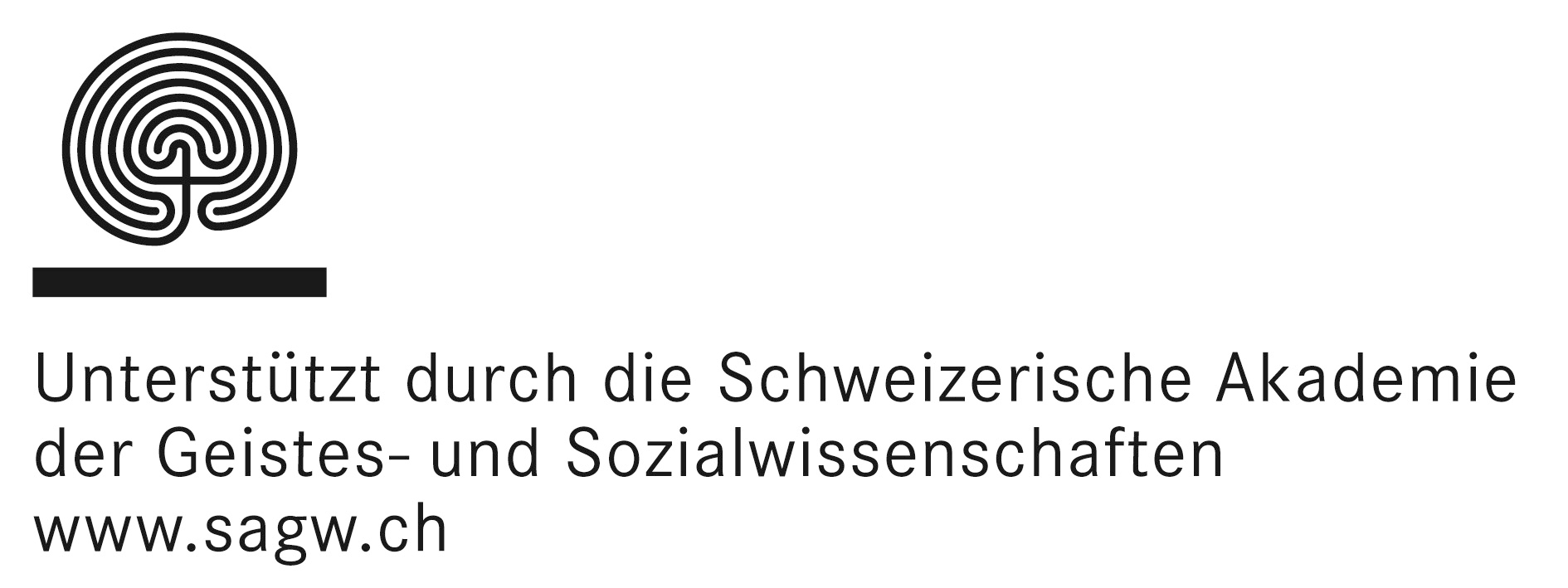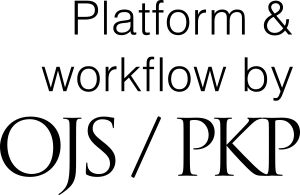La religion des autres. Plurivocation et équivocation : des enjeux éthiques de l'épistémologie en sciences des religions
DOI:
https://doi.org/10.26034/fr.zfrk.2015.008Abstract
Das gymnasiale Ergänzungsfach „Histoire et sciences des religions“ thematisiert Religionsfragen unter dem Blickwinkel der Kulturwissenschaften. Die „wissenschaftliche Neutralität“ dieses Zugangs kann paradox werden bzw. zu einer unsachgemässen Pädagogik führen, sobald Schülerinnen und Schüler mit einer glaubensbestimmten Optik an die Themen herangehen. Der Unterricht bringt sie als „Untersuchungsgegenstand“ ins Spiel, spricht von diesen Schülerinnen und Schülern in der dritten Person, obschon sie anwesend sind, und zudem werden ihre Glaubensbekenntnisse als ungültig betrachtet. Ohne auf kulturwissenschaftliche Paradigmen zu verzichten, erlaubt eine Epistemologie der Gleichwertigkeit aller Stimmen (Equivocation), mittels Begriffen wie Praxis oder Lebensform (Wittgenstein) eher Schlüsse zu ziehen, als mittels der Differenzen wahr/falsch oder gläubig/ungläubig. Eine solche Herangehensweise achtet auch auf die Diversität der anwesenden Stimmen und erlaubt ihnen aufeinander einzugehen, ohne dass eine der Stimmen einen entscheidenden Einfluss auf die anderen ausübt oder gar verlangt, sich zu einigen.Downloads
Veröffentlicht
13.10.2015
Ausgabe
Rubrik
Modelle und Theorien
Lizenz
Copyright (c) 2015 Claude Welscher

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.