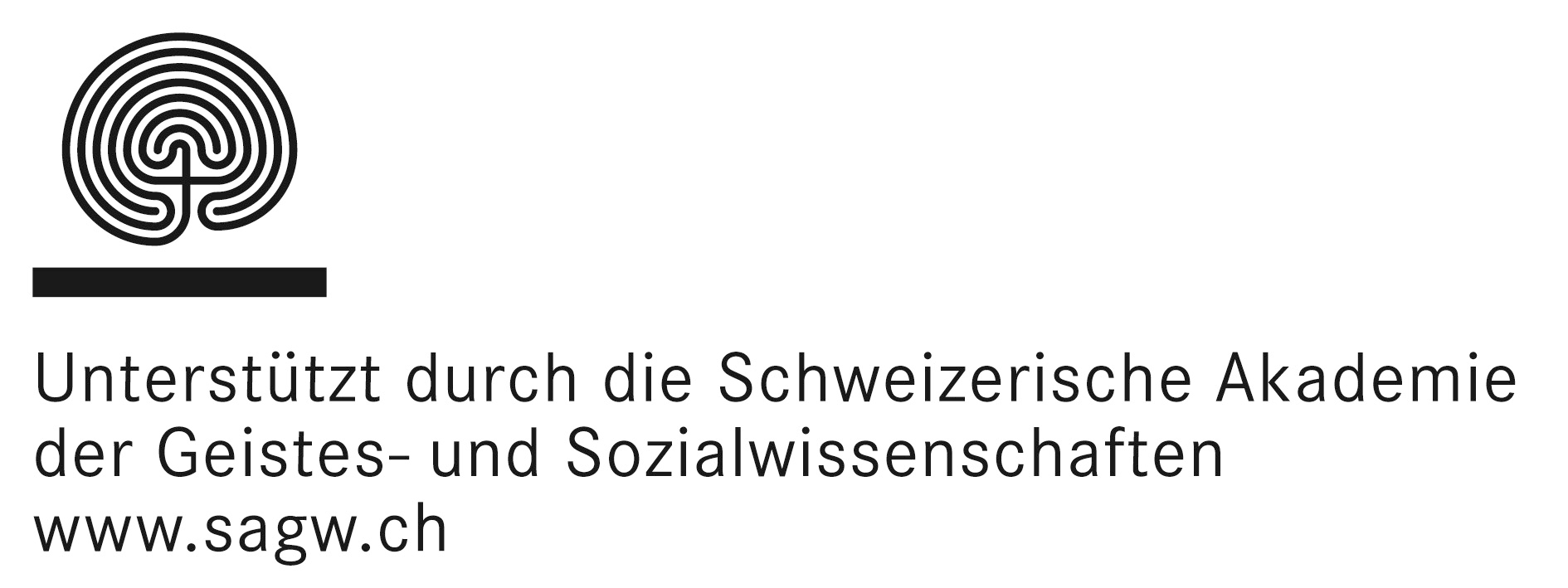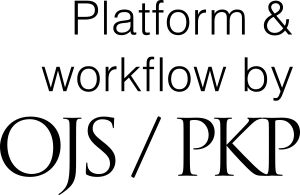Call for paper - Religiöse Neutralität – Notwendigkeit und Grenzen eines zentralen Konzepts für religionskundlichen Unterricht // Religious neutrality - necessity and limits of a central concept for religious education
For English, see below
Religiöse Neutralität ist ein häufig verwendetes Konzept, um ein bestimmtes rechtliches Verhältnis zwischen Staat und Religion zu beschreiben. Dieses meint zum Beispiel, dass ein Staat keine Religion bevorzugt oder den Bürger:innen die Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert. Wie dies im Einzelnen interpretiert wird und zu welcher Verhältnisbestimmung von Staat und Religion dies führt, ist immer wieder Gegenstand von Debatten und unterscheidet sich von Staat zu Staat und ist auch innerhalb der einzelnen Staaten nicht einheitlich geregelt. Ein solches Verhältnis bestimmt auch die Ausrichtung des obligatorischen schulischen Religionsunterrichts in der Volksschule. In der Regel wird gefordert, dass dieser religiös neutral sein muss. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergänzt, dass ein Unterricht, der sich an alle Schüler:innen richtet, objektiv, kritisch und pluralistisch sein soll.
In der Schweiz hat die Diskussion um die religiöse Neutralität von Schule und Lehrpersonen mit der Einführung von obligatorischen Formen des Religionsunterrichts, wie «Religion und Kultur» im Zürcher Lehrplan von 2010, «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» im Lehrplan 21 oder in «Ethique et culture religieuse» im Plan d'études romand eine wichtige Rolle gespielt. Denn ein Obligatorium tangiert die in der Bundesverfassung garantierte «Glaubens und Gewissensfreiheit» (Art. 15), die es dem Staat verbietet, jemanden zum Besuch von religiösem Unterricht zu zwingen. Der obligatorische schulische Religionsunterricht in der Volksschule kann daher nicht konfessionell verantwortet und gestaltet werden und wird als Zusicherung der Religionsfreiheit als «religiös neutral» taxiert (Frank, 2018).
Was diese Neutralität aber genau bedeutet, was sie umfasst und ob sie didaktische und pädagogische Anliegen zu bestimmen vermag, bleibt diskussionswürdig und es ist an der Zeit, die Neutralitätsdiskussion auf den Ebenen des Rechts, der Schule, der Lehrpersonen und insbesondere der Fachdidaktik und Pädagogik zu vertiefen. Angesichts aktueller fachwissenschaftlicher Diskussionen, dass jegliche Religionsforschung immer standpunktgebunden ist und deshalb nicht neutral sein kann – stellt sich grundsätzlich die Frage, ob «Neutralität» für den religionskundlichen Unterricht (noch) fruchtbar ist.
Folgende Fragen stellen sich dabei:
- Wie ist es beispielsweise historisch einzuordnen, dass der Lehrplan 21 scheinbar widersprüchliche Grundlagen beschreibt (christliche Wertvorstellungen vs. religiöse, konfessionelle Neutralität) und wie ist dies für die Praxis zu interpretieren.
- Welche Schulhauskultur lässt sich aus dem Postulat religiöser Neutralität ableiten? Abwesenheit von Religion im Schulalltag oder ausgewogene Repräsentation verschiedener Religionen? Was ist rechtmässig und was ist gesellschaftlich angemessen?
- In welchem Verhältnis ist religiöse Neutralität zur Normativität von Bildung zu denken?
- Was bedeutet Neutralität in den religionsbezogenen Schulfächern? Gilt hier eine besondere Neutralität? Was leistet diese und wie kommt sie zum Ausdruck? Wo liegen ihre fachlichen und bildungstheoretischen Grenzen?
- Wie kann und soll sich Neutralität bei Lehrpersonen ausdrücken? In der Auswahl der Lerngegenstände, in deren Inszenierung, in der Wahl der Lernziele, in der Sprache? Wo unterstützt Neutralität pädagogisches Handeln und wo wird sie fragwürdig oder gar hinderlich für das Lernen und die Entwicklung der Schüler:innen? Wo wird es vielleicht sogar zur Pflicht, die neutrale Position aufzugeben und Stellung zu beziehen?
- Und schliesslich: Kann der Begriff «Neutralität», der primär aus Diskursen des Rechts entstammt, das, was fachdidaktisch und pädagogisch angesprochen sein will, hinreichend benennen?
Wir freuen uns über alle Beiträge, die sich mit diesen und allen weiteren Fragen rund um religiöse Neutralität auseinandersetzen – sei dies konzeptionell, empirisch oder mit Schwerpunkten im Unterricht.
Der Eingabeschluss ist der 30. April 2025.
Wie immer nehmen wir bis zu diesem Datum auch gerne Beiträge entgegen, die sich nicht auf die oben genannten Themen beziehen.
Religious neutrality - necessity and limits of a central concept for religious education
Religious neutrality is a frequently used concept to describe a certain legal relationship between the state and religion. It means, for example, that a state does not favour any religion and that it guarantees its citizens freedom of thought, conscience, and religion. How this is interpreted in detail and how the relationship between state and religion is defined is the subject of constant debate and differs from state to state and is not uniformly regulated even within individual states. Such a relationship also determines the orientation of mandatory religious education in primary schools. As a rule, it is required to be religiously neutral. A recent judgement by the European Court of Human Rights adds that lessons aimed at all pupils should strive to be objective, critical and pluralistic.
In Switzerland, the discussion about the religious neutrality of schools and teachers has become central with the introduction of mandatory forms of religious education or education concerning religions, such as ‘Religion and Culture’ in the 2010 Zurich curriculum, ‘Ethics, Religions, Community’ in the Swiss German Lehrplan 21 or ‘Éthique et culture religieuse’ in the Plan d'études romand. Indeed, the Federal Constitution article which guarantees ‘freedom of religion and conscience’ (Art. 15) prohibits the state from compelling anyone to attend any “religious education”. Mandatory religious education or education on religions in the public school system can therefore not be organised by any religious authority or on a denominational basis, and must be ‘religiously neutral’ as a guarantee of religious freedom (Frank, 2018).
However, what this neutrality exactly means, what it encompasses and whether it can help define didactic and pedagogical concerns remains debatable and it is time to deepen the discussion on neutrality at the levels of law, school, teachers, and in particular didactics and pedagogy. Considering the current academic opinion that all religious research is always based on a particular point of view and therefore cannot be fully neutral, the fundamental question arises as to whether ‘neutrality’ is a concept that is (still) fruitful for religious education.
The following questions merit renewed consideration:
- From a historical point of view, for instance, how should we understand the fact that the Swiss German Lehrplan 21 ascribes seemingly contradictory foundational values to the school system (Christian values vs. religious and denominational neutrality). How should this be interpreted in practice?
- What school culture can be derived from the postulate of religious neutrality? Does this neutrality mean an absence of religion in everyday school life or a balanced representation of different religions? What is lawful and what is socially appropriate?
- How should religious neutrality be considered in relation to normativity of education?
- What does this neutrality mean for religion-related school subjects? Does a special neutrality apply here? What does it achieve and how is it expressed? What are its limits in terms of subject and educational theory?
- How can and should neutrality be expressed among teachers? In the selection of study material, in its staging, in the choice of learning objectives, in the language? Where does neutrality support pedagogical action and where does it become questionable or even a hindrance to the students’ learning and development? Where does it perhaps even become a duty to abandon the neutral position and take a stand?
- And finally: Can the term ‘neutrality’, which primarily stems from legal discourse, adequately describe what needs to be addressed from a didactic and pedagogical perspective?
We welcome all contributions that deal with these and all other questions relating to religious neutrality - whether conceptually, empirically or with a focus on teaching.
The deadline for submissions is 28 February 2025.
As always, we are also happy to accept contributions that do not relate to the above-mentioned topics with the same deadline.